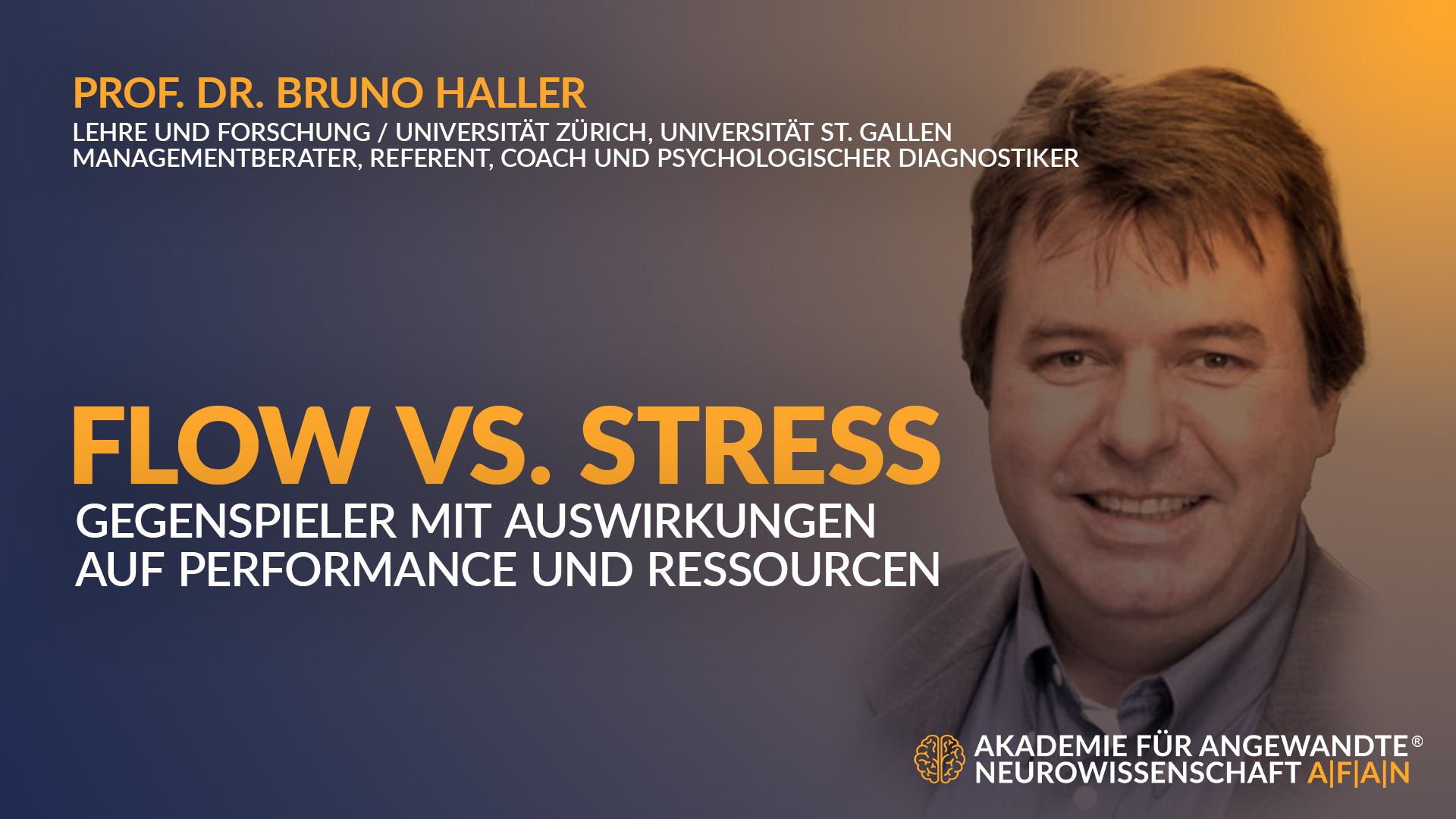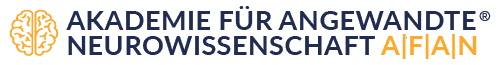Unser soziales Gehirn
Aufzeichnung des Akademietreffens
Warum Systembiologie die Medizin verändert: Einblicke in die Zukunft der Gesundheit
Systembiologie klingt zunächst abstrakt. Manche würden vielleicht sogar sagen futuristisch. Beim Akademietreffen mit Dr. Peter Spork zeigte sich jedoch schnell, wie greifbar und bedeutsam dieses Forschungsfeld für unseren Alltag wird. Denn die Systembiologie betrachtet den Menschen nicht länger als ein Puzzle aus einzelnen Symptomen, das man Stein für Stein zusammensetzen muss. Stattdessen versteht sie den Organismus als komplexes Netzwerk, in dem unzählige Faktoren gleichzeitig zusammenwirken. Peter brachte es treffend auf den Punkt:
»Das Leben ist hochkomplex, und genau so müssen wir es auch untersuchen.«
Die zentrale Idee besteht darin, Gesundheit als dynamischen Prozess zu begreifen, der sich über Zeit hinweg verändert. Mithilfe intelligenter Systeme lassen sich Muster erkennen, die ansonsten verborgen blieben. Dadurch wird es möglich, Entwicklungen schon im Vorfeld zu erkennen und frühzeitig gegenzusteuern.
Darüber sprach Akademieleiter Uli Funke mit Dr. Peter Spork, Wissenschaftsjournalist und Neurobiologe. Das Gespräch öffnete den Teilnehmenden einen realistischen Blick in die Zukunft der Medizin, die deutlich näher liegt, als viele denken.
Der Gast des Abends, Dr. rer. nat. Peter Spork, ist seit Jahrzehnten einer der bekanntesten deutschsprachigen Wissenschaftsjournalisten. Seine Schwerpunkte liegen in der Epigenetik, Neurobiologie und der modernen biomedizinischen Forschung. Durch seine langjährige Erfahrung gelingt es ihm, komplizierte Zusammenhänge so zu erklären, dass auch Menschen ohne naturwissenschaftlichen Hintergrund sie nachvollziehen können.
Systembiologie: Einführung in ein neues Verständnis von Gesundheit
Zum Einstieg erklärte Peter, dass Systembiologie keineswegs ein Randgebiet ist. Forschende weltweit arbeiten in Instituten, die sich diesem Ansatz widmen. Ihr Ziel besteht darin, biologische Prozesse über die Zeit hinweg zu berechnen und dadurch besser zu verstehen. Dazu gehören Daten aus Genetik, Epigenetik, Mikrobiom, Schlaf, Ernährung, Verhalten sowie Umweltfaktoren. Diese Informationen werden nicht einzeln ausgewertet, sondern miteinander verknüpft.
Die Systembiologie ermöglicht es dadurch, die Entstehung komplexer Krankheiten vorausschauender zu begreifen. Sie erklärt, warum bestimmte Faktoren gemeinsam zu Erkrankungen führen, auch wenn sie einzeln betrachtet harmlos wirken würden. Oder wie Peter sagte:
»Systembiologie ist der Versuch, die Ganzheitlichkeit des Lebens wissenschaftlich abzubilden.«
Ganzheitlichkeit neu gedacht: Warum linearer medizinischer Blick nicht mehr ausreicht
Die klassische Medizin arbeitet häufig mit linearen Ursache-Wirkungs-Ketten. Wer ein Symptom hat, bekommt eine Diagnose und anschließend eine Behandlung. Doch so funktioniert das Leben nicht. Unser Organismus reagiert ständig auf viele Einflüsse gleichzeitig. Deshalb entstehen Krankheiten wie Bluthochdruck, Diabetes oder Depressionen durch ein Geflecht aus genetischen, epigenetischen, psychischen und sozialen Faktoren.
Peter erklärte eindrücklich, wie begrenzt lineare Erklärungen sind. Ein Beispiel dafür ist der sogenannte »essenzielle Bluthochdruck«. »Bei 95 Prozent der Betroffenen wissen wir nicht, woher er kommt«, sagte er. Medikamente können zwar helfen, erreichen aber oft nicht den gewünschten Effekt, weil die Ursachen vielschichtig sind.
Die Systembiologie versucht genau diese Komplexität zu erfassen. Dank moderner Datenanalyse entstehen Modelle, die die Wechselwirkungen zwischen Organen, Stoffwechselwegen und Umwelteinflüssen sichtbar machen. Dadurch lassen sich Muster erkennen, die früher unsichtbar blieben.
Peter stellte klar, dass viele Menschen Ganzheitlichkeit eher aus Bereichen wie der Esoterik kennen. Dort wird sie jedoch meist ohne empirische Methoden beschrieben. Die Systembiologie dagegen verbindet Ganzheitlichkeit mit wissenschaftlicher Präzision.
»Wir ersetzen Bauchgefühl durch Berechnung, und zwar zum Nutzen der Menschen.«
Individuelle Medizin statt Durchschnittswerte: Warum Präzision der entscheidende Fortschritt ist
Ein weiterer zentraler Punkt des Abends drehte sich um die Frage, warum die heutige Medizin nur bedingt personalisiert ist. Medikamente werden häufig für den »durchschnittlichen Menschen« entwickelt, obwohl niemand diesem Durchschnitt entspricht. Peter betonte:
»Wir sind alle verschieden, trotzdem werden wir behandelt, als wären wir gleich.«
Faktoren wie Geschlecht, Alter, genetische Ausstattung, epigenetische Prägung, Lebensstil oder Schlafverhalten beeinflussen stark, wie wir auf Medikamente oder Stress reagieren. Die Systembiologie schafft erstmals eine Grundlage, diese Vielfalt zu berücksichtigen.
Peter stellte das Konzept der Präzisionsgesundheit vor, das der US-Forscher Michael Snyder geprägt hat. Anders als die Präzisionsmedizin betrachtet sie nicht nur Krankheiten, sondern den gesamten Zustand eines Menschen. Der Fokus richtet sich darauf, Gesundheit zu erhalten, anstatt erst bei Krankheit zu reagieren.
Ein besonders anschauliches Beispiel ist die Studie »Air Louisville«. Dort wurden Asthma-Sprays mit GPS-Sensoren ausgestattet, um herauszufinden, wann und wo Atemnot entsteht. Nach der Auswertung wurde die Stadtstruktur gezielt verändert. Die Folge: Die Atemnotfälle sanken um beeindruckende 78 Prozent. Dieses Beispiel zeigt, wie stark unser Umfeld die Gesundheit prägt und wie wirkungsvoll präventive Maßnahmen sein können.
Digitale Zwillinge: Simulationen, die unsere Gesundheit verstehen
Ein Höhepunkt des Abends war die Diskussion über digitale Zwillinge. Dabei handelt es sich um digitale Modelle eines Menschen, die biologische Eigenschaften, Gewohnheiten und Umweltfaktoren kombinieren. Sie dienen dazu, mögliche Zukunftsszenarien zu berechnen.
Peter erklärte: »Der digitale Zwilling hilft uns zu sehen, wie sich unser Leben entwickelt, wenn wir bestimmte Entscheidungen treffen.«
Dazu gehören Fragen wie:
-
Wie verändert sich mein Risiko für Diabetes, wenn ich ab morgen mehr schlafe?
-
Was passiert, wenn ich anfange zu joggen?
-
Welche Medikamente wirken bei mir am besten?
-
Welche Routinen unterstützen meine langfristige Gesundheit?
Er stellte klar, dass solche Modelle drei Voraussetzungen benötigen: ein solides biologisches Verständnis, umfangreiche individuelle Daten und die nötige Rechenleistung. Erst wenn diese drei Elemente zusammenkommen, werden Vorhersagen zuverlässig.
Besonders spannend war der Beitrag von Iris aus der Gruppe. Sie zeigte, wie sie bereits ihren eigenen kleinen digitalen Zwilling gebaut hat, indem sie Blutwerte, biografische Faktoren und Verhaltensdaten miteinander verrechnet. Diese Praxisnähe machte das Konzept greifbar und zeigte, dass solche Ansätze nicht mehr nur Zukunftsvision sind.
Daten und Ethik: Wie eine sichere und verantwortungsvolle Gesundheitszukunft aussehen kann
Der Umgang mit Gesundheitsdaten gehört zu den kontroversesten Themen des Abends. Peter betonte jedoch, dass Daten nicht das Problem sind, sondern der Umgang mit ihnen.
»Das Missbrauchsrisiko ist real, aber die Chancen sind zu groß, um sie zu ignorieren.«
Er sprach sich dafür aus, Daten in gemeinwohlorientierten Strukturen zu sichern. Beispiele dafür sind Genossenschaften wie MIDATA in der Schweiz. Dort entscheiden die Genossenschaftsmitglieder selbst, wer ihre Daten bekommt und zu welchem Zweck sie genutzt werden dürfen.
Peter machte deutlich, dass Datenberatung künftig ein eigener Beruf sein könnte. Ähnlich wie Bankberater heute über Geldanlagen informieren, könnten Datenberater Menschen dabei unterstützen, verantwortungsbewusst mit Gesundheitsdaten umzugehen.
Er schloss das Akademietreffen mit der klaren Aussage:
»Es wäre ethisch falsch, die Forschung zu stoppen. Wir müssen lernen, sie so zu gestalten, dass sie den Menschen dient.«
Takeaways dieses Akademietreffens
- Systembiologie schafft eine wissenschaftlich fundierte Sicht auf Ganzheitlichkeit.
- Präzisionsgesundheit ermöglicht Vorhersagen, bevor Krankheiten entstehen.
- Digitale Zwillinge simulieren individuelle Entscheidungen und deren Folgen.
- Gesundheitsdaten müssen in sicheren, ethisch verantwortlichen Strukturen liegen.
- Die Medizin der Zukunft wird personalisierter, präventiver und datenbasierter sein.
Länge 83 Minuten | Aufzeichnung vom Akademietreffen am 25.11.2025
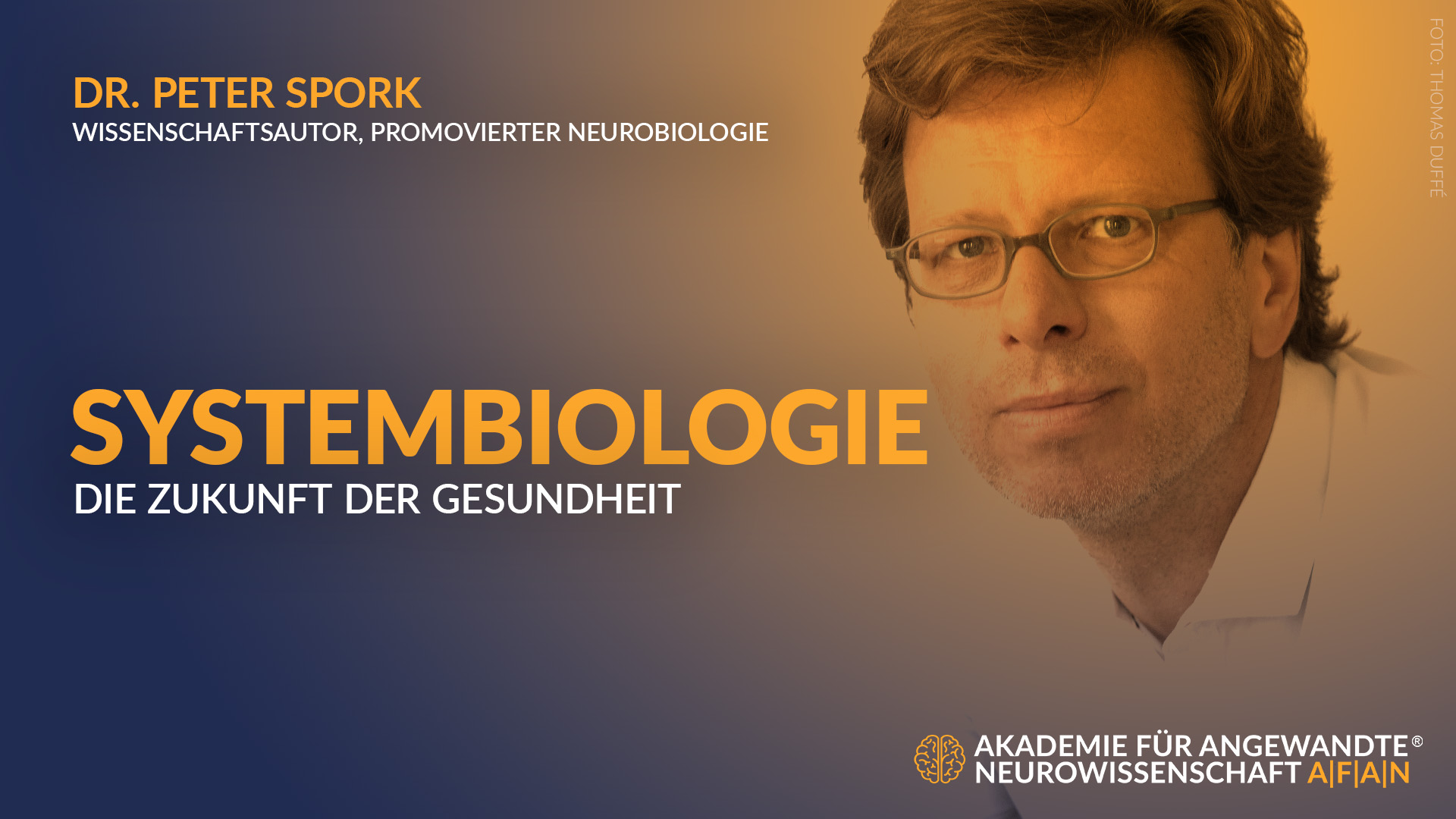
Inhalt nur für eingeloggte Mitglieder sichtbar.
Hier die Aufzeichnung anschauen: