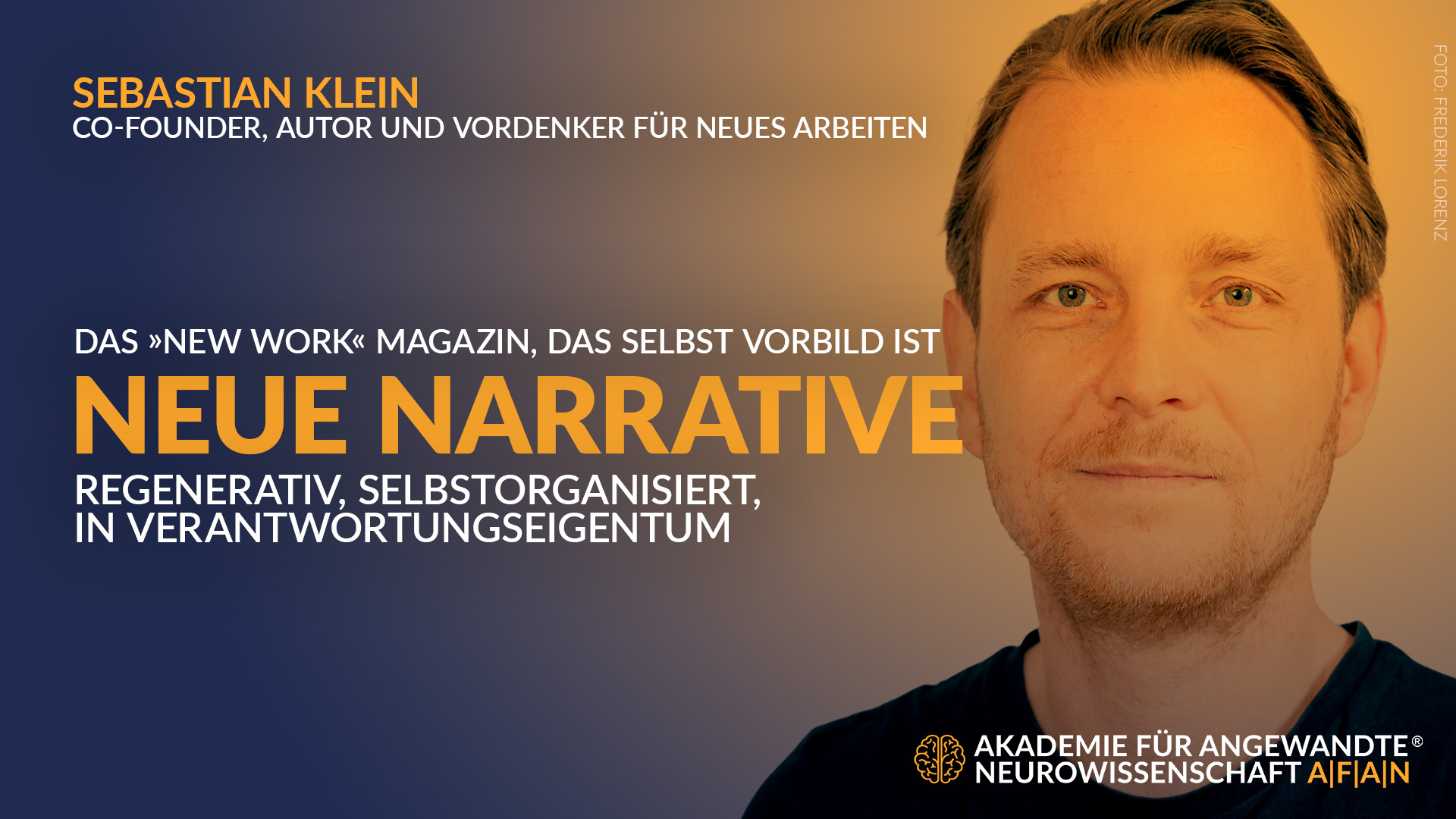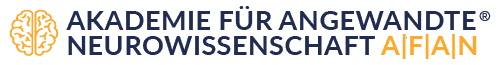Neurodivergenz verstehen
Aufzeichnung des Akademietreffens
Neurodivergenz verstehen – warum anders sein völlig normal ist
»Alle Menschen sind besonders«, sagt Florian Malicke, »Inkluencer« und Neurodiversitäts-Experte, im Gespräch mit Akademieleiter Uli Funke. Doch neurodivergente Persönlichkeiten – Menschen mit Autismus, ADHS oder anderen neurologischen Besonderheiten – erleben oft Ausgrenzung oder Missverständnisse. Dabei steckt in ihrer Wahrnehmung und Arbeitsweise großes Potenzial. Im Akademietreffen wurde deutlich: Es braucht nicht komplizierte Theorien, sondern Offenheit, Empathie und kleine Anpassungen im Miteinander.
Einblicke in die Welt der Neurodivergenz
Das Thema Neurodivergenz ist für viele noch neu. Selbst in Fachkreisen fällt der Begriff selten. Florian Malicke möchte das ändern: Er ist selbst Autist, lebt mit ADHS und begleitet seit über 30 Jahren neurodivergente Persönlichkeiten in Coaching, Beratung und Workshops. Bekannt als »Inkluencer« – ein Begriff, den ihm die Inklusionsbeauftragte von Google verliehen hat – teilt er seine eigene Erfahrung und sein Fachwissen in den sozialen Medien, in Vorträgen und im persönlichen Coaching.
Für die Mitglieder der Akademie ist das Thema hochrelevant: Wer Führungsverantwortung trägt, coacht oder berät, begegnet unweigerlich Menschen mit unterschiedlichen neurologischen Profilen. Die Frage ist nicht, ob es diese Vielfalt gibt – sondern wie wir damit umgehen.
Selbstakzeptanz durch Diagnose
Florian erzählt offen von seiner späten Diagnose. Erst mit über 40 Jahren ließ er abklären, was ihn schon lange beschäftigte. Die Diagnose Autismus und ADHS war für ihn ein Wendepunkt:
»Es war ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur Selbstakzeptanz.«
Plötzlich ergaben viele Erfahrungen Sinn, und er konnte mit sich selbst freundlicher umgehen.
Dabei betont er, dass Neurodivergenz keine Krankheit sei, sondern eine Variante menschlicher Gehirnstruktur. Neurodiversität umfasst uns alle – denn kein Gehirn gleicht dem anderen. Neurodivergenz beschreibt die Formen, die von der gesellschaftlich definierten Norm abweichen. Betroffenen kann eine Diagnose helfen, Zugang zu Unterstützung zu bekommen – vor allem aber stärkt sie die Selbstakzeptanz.
Das doppelte Empathie-Problem
Ein zentrales Thema im Gespräch war das Missverständnis rund um Empathie. Oft heißt es, autistische Menschen hätten keine Empathie. Florian widerspricht entschieden:
»Ich verstehe die neurotypische Gesellschaft häufig nicht – aber sie versteht mich genauso wenig.«
Dieses »Double Empathy Problem« zeigt, dass Kommunikation zwischen unterschiedlichen Wahrnehmungswelten scheitern kann – nicht aus Mangel an Gefühl, sondern aus fehlender Übersetzung.
Für Führungskräfte und Coaches bedeutet das: Irritationen entstehen nicht, weil jemand »falsch« ist, sondern weil die Gesprächslogik anders funktioniert. Einfache, klare Kommunikation, Nachfragen und das Zulassen unterschiedlicher Ausdrucksformen können Brücken bauen.
Reizüberflutung und Maskierung
Viele neurodivergente Menschen erleben Hyper- oder Hyposensibilität. Leichte Berührungen können schmerzhaft sein, während Druck beruhigend wirkt. Geräusche, Licht oder Gerüche prasseln ungefiltert auf sie ein.
»Ich höre und sehe oft zu viel auf einmal – und das kann in die Überlastung führen.«
Um in der Gesellschaft zu bestehen, maskieren viele – sie lernen Blickkontakt, Small Talk oder Körpersprache nach. Doch dieses »Anpassen« kostet enorme Energie und führt oft zu psychischen Belastungen wie Depressionen oder Angststörungen. Spätdiagnostizierte berichten fast immer von solchen Folgeproblemen.
Das Bewusstsein dafür ist entscheidend, auch im Arbeitskontext: Nicht jede*r kann offen über eigene Bedürfnisse sprechen, weil Angst vor Stigmatisierung besteht. Führungskräfte sollten daher sensibel hinschauen und nicht vorschnell urteilen.
Potenziale von Neurodivergenz im Arbeitsleben
Trotz aller Herausforderungen betont Florian die besonderen Stärken neurodivergenter Menschen. Hohe Detailgenauigkeit, Mustererkennung, Kreativität oder monotrope Konzentration auf Spezialthemen sind nur einige Beispiele.
»Wenn mich etwas interessiert, bin ich innerhalb kürzester Zeit Experte in diesem Thema.«
Unternehmen, die ein inklusives Umfeld schaffen, profitieren von dieser Vielfalt. Beispiele aus der Praxis zeigen, dass Teams produktiver, kreativer und resilienter werden, wenn unterschiedliche Arbeitsweisen zugelassen werden. Entscheidend ist »Inclusive Leadership«: klare Kommunikation, psychologische Sicherheit, flexible Strukturen.
Takeaways dieses Akademietreffens
- Neurodivergenz ist keine Krankheit, sondern eine Variante menschlicher Vielfalt.
- Spätdiagnosen können ein wichtiger Schritt zur Selbstakzeptanz sein.
- Empathie funktioniert in beide Richtungen – es braucht Übersetzung statt Vorurteile.
- Reizüberflutung und Maskierung sind zentrale Herausforderungen im Alltag.
- Neurodivergente Menschen bringen besondere Stärken in Teams ein.
- Inclusive Leadership schafft Räume, in denen alle Potenziale sichtbar werden.
- Offene Fragen und klare Kommunikation sind der Schlüssel zu gelingendem Miteinander.
-
Länge 73 Minuten | Aufzeichnung vom Akademietreffen am 22.09.2025
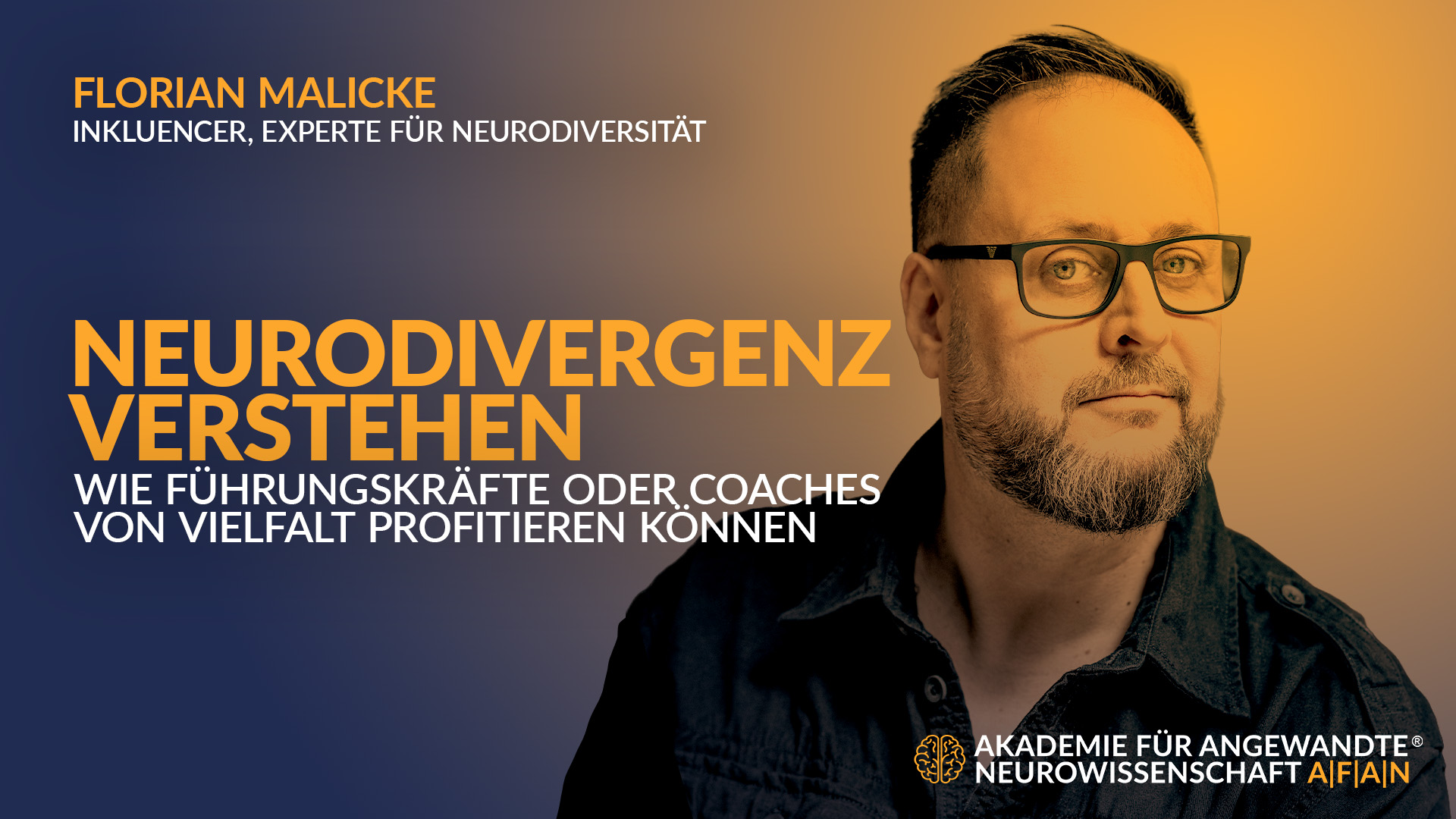
Inhalt nur für eingeloggte Mitglieder sichtbar.
Hier die Aufzeichnung anschauen: